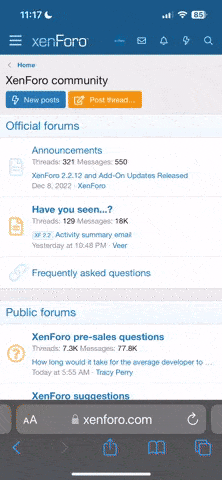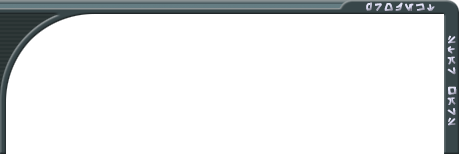Dust Bunny
Dust Bunny beginnt wie ein schräges Märchen. Staub wirbelt durch ein Kinderzimmer, sammelt sich, bekommt eine Form. Ein Monster entsteht. Schon in diesen ersten Minuten ist klar, dass das hier keine normale Welt ist. Alles wirkt künstlich, überhöht, wie eine Bühne. Für mich funktioniert der Film nur, wenn man ihn komplett als Fantasie begreift. Nicht als Spiel mit der Frage, ob das Monster vielleicht doch real ist. Sondern als geschlossene Innenwelt eines Kindes.
In dieser Traumwelt gelten andere Regeln. Räume leuchten in giftigen Farben. Tapeten scheinen zu leben. Und vor allem: Menschen, die sich dem Mädchen in der Wohnung nähern, werden gefressen. Das ist kein Zufall, das ist ein Muster. Wer ihr zu nahe kommt, verschwindet. Wer den Raum betritt, wird ausgelöscht.
Wenn man das ernst nimmt, bekommt das Ganze eine andere Schwere.
Denn dann ist das Monster nicht einfach nur ein Gruselmotiv, sondern eine Schutzfigur. Etwas, das eingreift, wenn Grenzen überschritten werden. Eine radikale, kindliche Form von Abwehr. In dieser Lesart wirkt die Wohnung wie ein innerer Schutzraum. Und jeder Erwachsene, der ihn betritt, wird zur potenziellen Bedrohung.
Man kann das als Verarbeitung lesen. Als Versuch, etwas Unaussprechliches in Bilder zu übersetzen. Die Idee, dass Nähe gefährlich ist. Dass Berührung Konsequenzen hat. Dass der eigene Raum verteidigt werden muss. Wenn man an die Möglichkeit denkt, dass das Mädchen Erfahrungen gemacht hat, die mit Grenzverletzung oder sexuellem Missbrauch zu tun haben, dann bekommt das Monster eine neue Bedeutung. Es frisst nicht wahllos. Es frisst diejenigen, die ihr zu nahe kommen.
In einer Traumwelt muss das nicht logisch erklärt werden. Da wird nicht psychologisch sauber analysiert. Da entstehen Bilder. Und diese Bilder sprechen.
Gerade deshalb fällt Auroras ruhige Art noch stärker auf. Sie zeigt kaum echte Panik. Kaum körperliche Angst. Keine unkontrollierten Ausbrüche. Sie wirkt abgeklärt, fast nüchtern. Das kann man als Distanz lesen, als Abspaltung. Wenn Angst zu groß wird, wird sie manchmal nicht laut, sondern still. Nicht zittrig, sondern hart. Trotzdem bleibt das Problem, dass der Film diese innere Spannung nur andeutet. Die Angst wird behauptet, aber selten wirklich erfahrbar gemacht.
Und dann ist da Mads Mikkelsen.
Sein Auftragskiller steht wie ein Fremdkörper in dieser Traumwelt, aber ein notwendiger. Er ist die einzige erwachsene Figur, die nicht sofort als Bedrohung markiert wird. Er dringt zwar in ihren Raum ein, aber er wird nicht gefressen. Im Gegenteil. Er wird zum Verbündeten. Zum Beschützer. In einer möglichen Missbrauchs-Lesart bekommt das Gewicht. Er ist der Gegenentwurf zu den anderen Erwachsenen. Kein Übergriff, keine Grenzüberschreitung, sondern klare Linien. Distanz, die respektvoll ist.
Mikkelsen spielt das ruhig, fast zurückgenommen. Und gerade dadurch wirkt es glaubwürdig. Er ist kein strahlender Retter, sondern jemand mit eigener Dunkelheit. Aber er respektiert ihre Regeln. Und das ist entscheidend. In einer Welt, in der Nähe gefährlich ist, wird er zur Ausnahme.
Die Szenen zwischen den beiden gehören zu den stärksten des Films. Da entsteht tatsächlich etwas wie Vertrauen. Kein kitschiges Ersatzvater-Drama, sondern eine vorsichtige Annäherung. Zwei Figuren, die sich gegenseitig prüfen.
Leider traut sich der Film nicht ganz, diese dunkle Lesart klarer zu machen. Er streift sie, aber er bleibt vage. Vielleicht aus Angst vor Eindeutigkeit. Vielleicht, weil er seine Märchenhaftigkeit nicht verlieren will. Doch gerade wenn man die Traumlogik akzeptiert, hätte er hier tiefer gehen können.
So bleibt
Dust Bunny ein Film, der viel andeutet. Der visuell stark ist, der Bilder findet für Bedrohung und Abwehr, für Nähe und Gefahr. Aber emotional bleibt er auf Abstand. Ich sehe, was darin stecken könnte. Ich sehe die mögliche Geschichte über ein Kind, das sich mit Fantasie schützt. Und ich sehe in Mikkelsens Figur eine positive, stabile Gegenkraft.
Nur hätte ich mir gewünscht, dass der Film den Mut hat, das deutlicher fühlbar zu machen. Dann wäre aus diesem schillernden Traum vielleicht ein wirklich erschütterndes Märchen geworden.