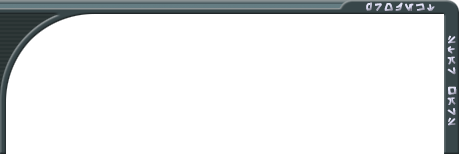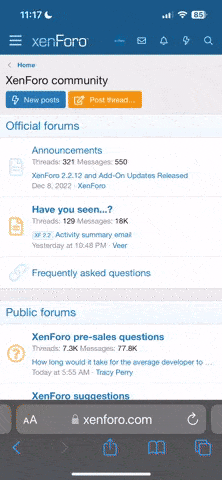Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke
Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke wirkt nicht geschniegelt, nicht geschniegelt-komisch, nicht geschniegelt-tiefsinnig. Er wirkt eher so, als hätte jemand genau hingeschaut und dann einfach ehrlich erzählt, was er gesehen hat. Das macht ihn so angenehm. Und auch so witzig, ohne dass er sich dafür anstrengen müsste.
Im Zentrum steht Joachim, Anfang zwanzig, der nach dem Tod seines Bruders aus dem Norden nach München geht und überraschend an der Otto-Falckenberg-Schule aufgenommen wird. Eigentlich müsste das der große Aufbruch sein, aber Joachim wirkt von Anfang an wie jemand, der sich im falschen Film wiederfindet. Während andere sofort losspielen, improvisieren, sich verrenken und scheinbar mühelos aus sich herausgehen, steht er da und weiß nicht, wohin mit sich. Er soll beispielsweise mit den Brustwarzen lächeln oder sich vorstellen, er sei Spaghetti im kochenden Wasser, die langsam weich werden. Das ist auf der Leinwand oft sehr komisch, für Joachim aber vor allem peinlich, manchmal geradezu demütigend. Die Übungen erscheinen ihm nicht befreiend, sondern wie Prüfungen, für die er keine Sprache hat.
Richtig Halt findet Joachim nicht an der Schule, sondern bei seinen Großeltern, bei denen er in einer großen Villa nahe dem Nymphenburger Park einzieht. Dort läuft alles nach festen Regeln. Der Tag beginnt mit Champagner, weil sich damit die morgendlichen Tabletten leichter schlucken lassen. Der Großvater nimmt jede Pille einzeln und mit konzentrierter Sorgfalt ein, während die Großmutter alle Medikamente in einem Zug herunterschluckt und trocken anmerkt, sie wüssten schon, wohin sie gehören. Punktgenau um 18 Uhr wird Whisky eingeschenkt, ganz gleich, was sonst gerade los ist. Morgendliche Gymnastik wird notfalls innerlich absolviert. Wenn die Gelenke streiken, steht der Großvater regungslos auf dem Balkon und turnt im Kopf weiter. Klassische Musik wird liegend auf dem Wohnzimmerteppich gehört. Und am Abend, wenn der Alkohol wirkt, geraten die beiden regelmäßig in Diskussionen darüber, wer zuerst den Treppenlift ins Obergeschoss benutzen darf. Das ist schräg, manchmal urkomisch, aber nie bloßes Kuriositätenkabinett. Diese Ordnung gibt Joachim etwas, das ihm sonst fehlt: Ruhe. In diesem Haus muss er nichts beweisen. Er darf einfach da sein.
Erzählt wird das alles mit einer großen Selbstverständlichkeit. Es wird nichts tot erklärt und der Film verlässt sich darauf, dass die Figuren für sich sprechen. Gerade im Umgang mit den Großeltern zeigt sich das. Senta Berger ist als Großmutter eine Erscheinung: ein bisschen Diva, ein bisschen Theater, sehr präsent, aber nie laut auf eine unangenehme Weise. Michael Wittenborn spielt den Großvater als pedantischen, klugen, manchmal leicht giftigen Mann, hinter dessen Genauigkeit man schnell auch Verletzlichkeit erkennt. Zusammen sind sie kein Gag, sondern ein echtes Paar, das sich eingerichtet hat im Älterwerden.
Der Film springt ständig zwischen Schauspielschule und Großelternhaus hin und her, und genau daraus entsteht seine Kraft. Auf der einen Seite eine Welt, die ständige Offenheit verlangt, permanente Verfügbarkeit von Gefühlen, die Bereitschaft, sich auf Kommando zum Nilpferd, zur Nudel oder zur Maschine zu machen. Auf der anderen Seite ein Leben, das sich über Wiederholung, Gewohnheit und kleine Eigenheiten stabil hält. Joachim hängt dazwischen. Er weiß, dass er vorwärtsgehen muss, spürt aber gleichzeitig, wie sehr ihn das Vergangene festhält. Diese Spannung trägt den Film fast von allein.
Bruno Alexander spielt diesen Joachim sehr zurückgenommen. Er macht ihn nicht besonders sympathisch, eher verschlossen, manchmal stur, manchmal kindisch. Aber genau das passt. Man glaubt ihm jeden Moment der Unsicherheit, jede Verkrampfung. Wenn er scheitert, fühlt sich das nicht nach dramaturgischem Kniff an, sondern nach echter Überforderung. Und wenn ihm etwas gelingt, dann nicht, weil er plötzlich „gut“ ist, sondern weil er für einen Moment ehrlich wird.
Besonders stark ist eine Szene, in der Joachim vor anderen singen soll. Er entscheidet sich für
Tainted Love.. Das ist kein schöner, sauberer Auftritt. Er singt schief, zögernd, sichtbar nervös. Aber genau darin liegt etwas Echtes. Der Film macht hier keinen großen Punkt draus, erklärt nichts und genau deshalb wirkt es. Man versteht, dass es beim Spielen nicht um Technik geht, sondern darum, etwas zuzulassen, das man sonst versteckt.
Natürlich ist nicht alles perfekt. Man fragt sich gelegentlich, warum Joachim an der Schauspielschule so lange durchgeschleppt wird, obwohl er sich so offensichtlich querstellt. Aber das sind kleine Brüche, die dem Ganzen kaum schaden. Der Film verliert nie den Blick für seine Figuren, und das ist am Ende entscheidender als logische Strenge.
Was bleibt, ist ein warmer, kluger Film, der sich Zeit nimmt und seinen Humor nicht ausstellt. Man lacht viel, manchmal herzhaft, manchmal eher leise. Und immer schwingt etwas mit, das über den Witz hinausgeht: die Erfahrung von Verlust, die Suche nach einem Platz im Leben, das Gefühl, dass zwischen dem, was man ist, und dem, was man sein möchte, oft eine schmerzhafte Lücke klafft. Empfehlung.