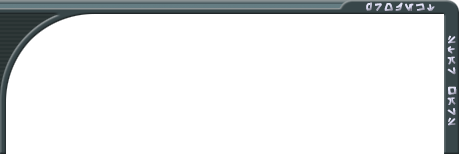App installieren
How to install the app on iOS
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
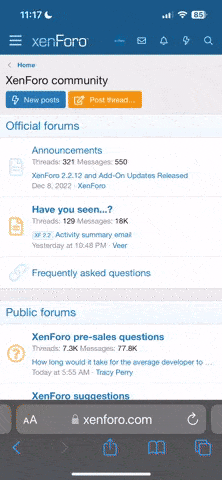
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
[SF-Abenteuer-Reihe] Jurassic Park
- Ersteller Darth Tyrannus
- Erstellt am
Sehr unterhaltsamer erster Schritt vom nächsten Arc... das einzige, was mich kurz rausgezogen hat, war der größenwechselnde D am Schluss des Filmes. Der Filmfehler is schon sehr amüsant ^____^
Update vom Ranking:
1. Jurassic Park
2. Jurassic World
3. Jurassic World Dominion
4. Jurassic World Rebirth
5. Jurassic Park III
6. Jurassic World: Fallen Kingdom
7. Lost World: Jurassic Park
Update vom Ranking:
1. Jurassic Park
2. Jurassic World
3. Jurassic World Dominion
4. Jurassic World Rebirth
5. Jurassic Park III
6. Jurassic World: Fallen Kingdom
7. Lost World: Jurassic Park
Zoey Liviana
Archäologin, Sithlady, Meisterin von Ari`a
Ich war auch schon im neuen Film "Die Wiedergeburt" und habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Es war ein typischer Jurassic-Parc-Film und die Story dazu fand ich prima. Es war sehr spannend mit einigen Erschreckern.^^ Ich schrie einmal total laut auf und das im Kino.^^ Anders als Sam R. fand ich die Story rund um die Familie ganz besonders spannend.
Sam Rockwell
durch Titel Gebeutelter
Was der Familie fehlt, sind für mich jene Ecken und Kanten, die Figuren zu echten Menschen machen. Menschen werden interessant, wenn sie innere Widersprüche mit sich tragen, wenn sie zweifeln, sich entwickeln oder in Konflikte geraten. Genau das bleibt hier aus. Tiefergehende emotionale Prozesse werden entweder nicht gezeigt oder nur vage angedeutet. Die Charaktere scheinen weniger aus eigener Überzeugung zu handeln, sondern vor allem deshalb, weil es der Fortgang der Handlung verlangt. Sie reagieren auf Bedrohungen, laufen, verstecken sich, schreien, überleben. Doch selten ist dabei erkennbar, dass ihre Entscheidungen aus einer inneren Logik oder glaubwürdigen Motivation entstehen.
Ein wesentlicher Grund dafür liegt in der klaren Zielgruppenstrategie des Films. Um ein möglichst breites Publikum anzusprechen, sollen die Figuren für viele anschlussfähig sein, also möglichst allgemein gehalten und leicht zugänglich. Dieser Ansatz wirkt zunächst nachvollziehbar, bringt jedoch einen Nachteil mit sich. Was universell wirken möchte, wirkt am Ende oft austauschbar. So bleibt die dargestellte Familie seltsam konturlos. Es fehlt an biografischer Tiefe, an Entwicklung, an Charaktermerkmalen, die sie unverwechselbar machen würden.
Dabei ist das Motiv der gefährdeten Familie im Kino keineswegs neu. Hollywood hat es seit Jahrzehnten immer wieder verwendet, oft sehr wirkungsvoll. In den frühen Jurassic Park-Filmen etwa wurden die Beziehungen zwischen den Figuren noch als echte Spannungsquelle genutzt. Man denke an Dr. Grant, der zu Beginn mit Kindern nichts anfangen kann und erst im Lauf der Geschichte eine neue Haltung entwickelt. Solche Entwicklungen fehlen hier fast vollständig.
In Die Wiedergeburt sind die Familienmitglieder in meinen Augen Bestandteil eines auf Tempo und Spektakel ausgerichteten Erzählmusters. Die menschliche Dimension bleibt dabei auf der Strecke. Was bleibt, ist ein Ensemble, das durch beeindruckende Kulissen läuft, aber kaum emotionale Spuren hinterlässt.
Ein wesentlicher Grund dafür liegt in der klaren Zielgruppenstrategie des Films. Um ein möglichst breites Publikum anzusprechen, sollen die Figuren für viele anschlussfähig sein, also möglichst allgemein gehalten und leicht zugänglich. Dieser Ansatz wirkt zunächst nachvollziehbar, bringt jedoch einen Nachteil mit sich. Was universell wirken möchte, wirkt am Ende oft austauschbar. So bleibt die dargestellte Familie seltsam konturlos. Es fehlt an biografischer Tiefe, an Entwicklung, an Charaktermerkmalen, die sie unverwechselbar machen würden.
Dabei ist das Motiv der gefährdeten Familie im Kino keineswegs neu. Hollywood hat es seit Jahrzehnten immer wieder verwendet, oft sehr wirkungsvoll. In den frühen Jurassic Park-Filmen etwa wurden die Beziehungen zwischen den Figuren noch als echte Spannungsquelle genutzt. Man denke an Dr. Grant, der zu Beginn mit Kindern nichts anfangen kann und erst im Lauf der Geschichte eine neue Haltung entwickelt. Solche Entwicklungen fehlen hier fast vollständig.
In Die Wiedergeburt sind die Familienmitglieder in meinen Augen Bestandteil eines auf Tempo und Spektakel ausgerichteten Erzählmusters. Die menschliche Dimension bleibt dabei auf der Strecke. Was bleibt, ist ein Ensemble, das durch beeindruckende Kulissen läuft, aber kaum emotionale Spuren hinterlässt.
Zoey Liviana
Archäologin, Sithlady, Meisterin von Ari`a
Das sehe ich anders. Der Vater kann mit dem Freund der Tochter nichts anfangen. Er mag ihn nicht. Der Freund ist faul, gedankenlos und ihm ist egal, was der Vater von ihm hält. Doch dann rettet er die Tochter. Der Vater sieht ihn anders. Dankt ihm. Die Gruppe wird erst im Dschungel unter den Dinos zur Gruppe, arbeitet zusammen. Ihr Ziel, in die Siedlung zu finden, um zu überleben. Die kleine Tochter ist total verängstigt, seit ihr Boot kenterte. Das zeigt die junge Schauspielerin hervorragend. Ihre Angst löst große Schuldgefühle beim Vater von Anfang an aus. Er hat die Familie in Gefahr gebracht. Ihre Retter kümmern sich nicht um sie, sondern es kommt zur Negativsache zwischen dem Typen der anderen Gruppe und der großen Tochter. Ich finde da absolut nichts konturlos.
Sam Rockwell
durch Titel Gebeutelter
Danke für deine Rückmeldung. Ich finde es spannend, wie unterschiedlich man denselben Film wahrnehmen kann. Du beschreibst mehrere Beziehungsmomente, die mir ebenfalls aufgefallen sind, zum Beispiel die veränderte Haltung des Vaters gegenüber dem Freund der Tochter. Für mich persönlich bleibt das allerdings eher eine angedeutete Skizze als eine echte Entwicklung.
Was mir fehlt, ist erzählerische Tiefe. Konflikte werden zwar gezeigt, aber oft nur kurz angerissen. Die Figuren reagieren, sie zeigen Gefühle wie Dankbarkeit oder Angst. Aber der Weg dorthin, also die innere Bewegung der Figuren, wird kaum sichtbar gemacht. Es fehlen ruhige Momente, in denen Charaktere wirklich miteinander sprechen, sich öffnen oder mit sich selbst ringen. Vieles wirkt wie ein erzählerisches Signal, nicht wie ein organischer Prozess.
Ein Beispiel dafür ist das Liebespaar selbst, also die ältere Tochter und ihr Freund. Gerade sie müssten als emotionale Bezugspersonen zueinander sprechen, sich austauschen, streiten oder auch zueinander finden. Doch von echter Kommunikation zwischen den beiden ist kaum etwas zu sehen. Sie agieren nebeneinander her, oft mit Blick auf das nächste Hindernis oder die nächste Bedrohung. Ihre Beziehung bleibt oberflächlich, fast leblos. Auch das trägt dazu bei, dass die Figuren für mich nicht wie echte Menschen wirken
Auch der Konflikt zwischen Vater und Freund ist aus meiner Sicht sehr schematisch. Es ist ein bekanntes Muster: der skeptische Vater erkennt am Ende den jungen Mann an. Doch diese Entwicklung bleibt sehr vorhersehbar und wird nicht wirklich ausgearbeitet. Es fühlt sich eher wie ein dramaturgischer Automatismus an. Ähnlich geht es mir mit der Angst der kleinen Tochter. Auch hier wird ein Zustand gezeigt, nicht eine Entwicklung. Die Angst wird nicht durchlebt, sondern als Funktion im Spannungsbogen eingesetzt.
Natürlich kann man sagen, es gibt emotionale Ansätze. Aber sie werden eher behauptet als wirklich erzählt. Es fehlt an Dialogen mit Substanz, an inneren Widersprüchen, an Charakterveränderungen, die über das Erwartbare hinausgehen. Deshalb wirken die Figuren für mich nicht wie echte Menschen, sondern eher wie Rollen innerhalb eines Action-Schemas.
Was mir fehlt, ist erzählerische Tiefe. Konflikte werden zwar gezeigt, aber oft nur kurz angerissen. Die Figuren reagieren, sie zeigen Gefühle wie Dankbarkeit oder Angst. Aber der Weg dorthin, also die innere Bewegung der Figuren, wird kaum sichtbar gemacht. Es fehlen ruhige Momente, in denen Charaktere wirklich miteinander sprechen, sich öffnen oder mit sich selbst ringen. Vieles wirkt wie ein erzählerisches Signal, nicht wie ein organischer Prozess.
Ein Beispiel dafür ist das Liebespaar selbst, also die ältere Tochter und ihr Freund. Gerade sie müssten als emotionale Bezugspersonen zueinander sprechen, sich austauschen, streiten oder auch zueinander finden. Doch von echter Kommunikation zwischen den beiden ist kaum etwas zu sehen. Sie agieren nebeneinander her, oft mit Blick auf das nächste Hindernis oder die nächste Bedrohung. Ihre Beziehung bleibt oberflächlich, fast leblos. Auch das trägt dazu bei, dass die Figuren für mich nicht wie echte Menschen wirken
Auch der Konflikt zwischen Vater und Freund ist aus meiner Sicht sehr schematisch. Es ist ein bekanntes Muster: der skeptische Vater erkennt am Ende den jungen Mann an. Doch diese Entwicklung bleibt sehr vorhersehbar und wird nicht wirklich ausgearbeitet. Es fühlt sich eher wie ein dramaturgischer Automatismus an. Ähnlich geht es mir mit der Angst der kleinen Tochter. Auch hier wird ein Zustand gezeigt, nicht eine Entwicklung. Die Angst wird nicht durchlebt, sondern als Funktion im Spannungsbogen eingesetzt.
Natürlich kann man sagen, es gibt emotionale Ansätze. Aber sie werden eher behauptet als wirklich erzählt. Es fehlt an Dialogen mit Substanz, an inneren Widersprüchen, an Charakterveränderungen, die über das Erwartbare hinausgehen. Deshalb wirken die Figuren für mich nicht wie echte Menschen, sondern eher wie Rollen innerhalb eines Action-Schemas.
Ich fand die Interaktionen und die Entwicklung der Familie (wachsende Akzeptanz, Übernahme von Verantwotung, Überwinden von Ängsten) auch sehr schön mit anzusehen. Konnte mit ihnen mitfühlen.
Ne, ausser dem mal großen und mal megagroßen D war da wenig, über das ich mich ernsthaft beschweren könnte...
Ne, ausser dem mal großen und mal megagroßen D war da wenig, über das ich mich ernsthaft beschweren könnte...
Ansiv Reeblac
Tleilaxu
mal großen und mal megagroßen D
Das hab ich irgendwie nicht gesehen....war das beides am Schluss?
Jo... der D-Rex ist schon groß, kann einen Menschen ohne Probleme in den Mund bekommen. Bei der Hubschrauberszene hat er aber dann den halben Hubschrauber im Maul und das is halt ordentlich daneben, wenn man ihn danach mit dem Jeep oder dem Boot vergleicht
Is aber imo nicht tragisch, passiert in Filmen immer mal wieder und die Szene an sich is ja cool ^__^
Is aber imo nicht tragisch, passiert in Filmen immer mal wieder und die Szene an sich is ja cool ^__^
Zoey Liviana
Archäologin, Sithlady, Meisterin von Ari`a
Sam, danke nochmal für deine Meinung, aber ich kann auch die nicht teilen. Wann sollten denn die Familienmitglieder tiefgreifende Gespräche führen? Das war doch bei ihrem Umfeld gar nicht möglich. Der Film ging gleich spannend los, was ich ausgezeichnet fand. Wir lernen die Familie kennen und sogleich haben sie Dinosaurierkontakt und kämpfen um ihr Leben. Hätten sie tiefgreifende Gespräche während des Angriffs auf dem Meer oder vorm T-Rex führen sollen? Das hätte ich persönlich dann sehr unreal und aufgesetzt gefunden. Außerdem hieß es auf der Insel sofort: "Sei leise!". Daher konnten sie kaum reden. Jedes Wort lockte Saurier an. Dennoch bekommen wir eine Menge der Familiendynamik mit. Siehe alles, was ich schon aufgezählt habe. Auch den Hintergrund des Ausfluges bekommen wir mit.
Zum Pärchen: Wir bekommen mit, dass die Tochter die Patzer ihres Freundes auszubügeln versucht. Sie liebt ihn trotzdem. Sie weiß um seine Stärken. Sie schämt sich aber teils auch für seine Patzer gegenüber dem Vater. Im Dschungel lehnt auch sie sich oft an ihren Vater an. Vor Angst sucht sie seine starke beschützende Schulter wie bisher als Kind. Beim Schlafen. Dennoch bemerken wir, dass die Familie zusammenwächst. Und der Freund ist nur ein Freund, kein Verlobter. Ich denke, es war vielleicht ihr erster Freund. Natürlich sagt der Vater nichts, wenn ihm etwas missfällt, weil er den Ausflug nicht versauen will und weil er seine Tochter samt Freund nicht vergraulen möchte. Im Dschungel sieht der Vater den Freund schon mit anderen Augen.
Für mich ist damit die Diskussion beendet. Ich denke, wir kommen da auf keinen gemeinsamen Nenner, aber das ist ja auch gar nicht der Sinn des Ganzen. Ich finde es immer wieder spannend, wie unterschiedlich Filme ankommen und wie verschieden Meinungen dazu sind und danke ganz besonders dir, Sam, für deine ausführliche Meinung, die ich interessiert gelesen habe.
Ps. Ich fand die spannendsten Szenen am Fluss, als die Tochter das Boot holen will und im Tunnelsystem am Ende des Films.
Zum Pärchen: Wir bekommen mit, dass die Tochter die Patzer ihres Freundes auszubügeln versucht. Sie liebt ihn trotzdem. Sie weiß um seine Stärken. Sie schämt sich aber teils auch für seine Patzer gegenüber dem Vater. Im Dschungel lehnt auch sie sich oft an ihren Vater an. Vor Angst sucht sie seine starke beschützende Schulter wie bisher als Kind. Beim Schlafen. Dennoch bemerken wir, dass die Familie zusammenwächst. Und der Freund ist nur ein Freund, kein Verlobter. Ich denke, es war vielleicht ihr erster Freund. Natürlich sagt der Vater nichts, wenn ihm etwas missfällt, weil er den Ausflug nicht versauen will und weil er seine Tochter samt Freund nicht vergraulen möchte. Im Dschungel sieht der Vater den Freund schon mit anderen Augen.
Für mich ist damit die Diskussion beendet. Ich denke, wir kommen da auf keinen gemeinsamen Nenner, aber das ist ja auch gar nicht der Sinn des Ganzen. Ich finde es immer wieder spannend, wie unterschiedlich Filme ankommen und wie verschieden Meinungen dazu sind und danke ganz besonders dir, Sam, für deine ausführliche Meinung, die ich interessiert gelesen habe.
Ps. Ich fand die spannendsten Szenen am Fluss, als die Tochter das Boot holen will und im Tunnelsystem am Ende des Films.
Sam Rockwell
durch Titel Gebeutelter
@Zoey Liviana
Vielen Dank für deine ausführliche Rückmeldung. Es ist deutlich spürbar, wie aufmerksam du den Film verfolgt hast. Wie du finde auch ich es faszinierend, wie unterschiedlich ein und dasselbe Geschehen wahrgenommen werden kann.
Für mich ist Kommunikation das Herzstück jeder Beziehung. Deshalb irritiert es mich besonders, dass das Liebespaar selbst in ruhigeren Momenten - etwa beim nächtlichen Lagern – nicht miteinander spricht oder sich erkennbar austauscht. Gerade dort hätte der Film Gelegenheit gehabt, ihrer Beziehung Tiefe zu verleihen.
Deine Einschätzung zu den spannungsgeladenen Szenen am Fluss kann ich gut nachvollziehen. Auch für mich zählen sie zu den überzeugendsten Momenten des Films. Ich hatte zufällig die Gelegenheit Die Wiedergeburt innerhalb der ersten sechs Tage nach Kinostart dreimal zu sehen. Ich mag sehr die Sequenzen rund um den Mosasaurus, für mich der inszenatorische Höhepunkt des Films.
@Aztlan
Ich habe gerade die Floßszene aus Dino Park noch einmal im Roman nachgelesen. Sie unterscheidet sich deutlich von der filmischen Umsetzung in Die Wiedergeburt. Die Szene in der ursprünglichen Drehbuchfassung von Jurassic Park steht der Romanvorlage offenbar näher. Im Buch findet die Begegnung mit dem T-Rex in einer Lagune statt, verläuft vergleichsweise weniger dramatisch und gipfelt darin, dass ein junger T-Rex, eher unfreiwillig, zum Retter der Hauptfiguren wird.
Vielen Dank für deine ausführliche Rückmeldung. Es ist deutlich spürbar, wie aufmerksam du den Film verfolgt hast. Wie du finde auch ich es faszinierend, wie unterschiedlich ein und dasselbe Geschehen wahrgenommen werden kann.
Für mich ist Kommunikation das Herzstück jeder Beziehung. Deshalb irritiert es mich besonders, dass das Liebespaar selbst in ruhigeren Momenten - etwa beim nächtlichen Lagern – nicht miteinander spricht oder sich erkennbar austauscht. Gerade dort hätte der Film Gelegenheit gehabt, ihrer Beziehung Tiefe zu verleihen.
Deine Einschätzung zu den spannungsgeladenen Szenen am Fluss kann ich gut nachvollziehen. Auch für mich zählen sie zu den überzeugendsten Momenten des Films. Ich hatte zufällig die Gelegenheit Die Wiedergeburt innerhalb der ersten sechs Tage nach Kinostart dreimal zu sehen. Ich mag sehr die Sequenzen rund um den Mosasaurus, für mich der inszenatorische Höhepunkt des Films.
@Aztlan
Ich habe gerade die Floßszene aus Dino Park noch einmal im Roman nachgelesen. Sie unterscheidet sich deutlich von der filmischen Umsetzung in Die Wiedergeburt. Die Szene in der ursprünglichen Drehbuchfassung von Jurassic Park steht der Romanvorlage offenbar näher. Im Buch findet die Begegnung mit dem T-Rex in einer Lagune statt, verläuft vergleichsweise weniger dramatisch und gipfelt darin, dass ein junger T-Rex, eher unfreiwillig, zum Retter der Hauptfiguren wird.
Aztlan
Ciudadano de Aztlan. Guerrero del Ejército Azteca
Na das schreit nach einem erneuten Lesen des Romans. Kann mich nur noch erinnern das ich die Fluss szene ziemlich cool fand, und das Hammond im Buch ein ziemlicher arsch ist. Im Film kam er mir immer viel netter vor. Aber ist auch ca 10 Jahre her seit ich es gelesen habe.
Sam Rockwell
durch Titel Gebeutelter
Bei mir ist es 32 Jahre her, dass ich Dino Park gelesen habe. Die Verfilmung hat meine Erinnerungen an den Roman fast vollständig überlagert. An die Floßszene konnte ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Aber ein guter Hinweis – es wäre wirklich lohnend, den Roman noch einmal zu lesen. Ich werde das vergilbte Buch nächste Woche als Strandlektüre nutzen.
Ansiv Reeblac
Tleilaxu
Bei mir sind es nur 10 Jahre her seit ich das Buch gelesen habe, aber ich kann mich jetzt schon kaum mehr daran erinnern.Bei mir ist es 32 Jahre her, dass ich Dino Park gelesen habe. Die Verfilmung hat meine Erinnerungen an den Roman fast vollständig überlagert
Es war jedenfalls sehr blutig, das hab ich mir gemerkt.
Verge of Greatness
Abgesandter
Jetzt habe ich richtig Lust auf die beiden Romane, die werde ich mir irgendwo gebraucht zusammen suchen.
Ich habe mal das Hörbuch verschenkt, weil die Filme so gut ankamen. Da gab es doch etwas sparsame Reaktionen angesichts langer Abhandlungen und dann doch ziemlich fieser Dino Action.
@Aztlan genau, das Baby.... Muss in Jurassic Park sein.
Ich habe mal das Hörbuch verschenkt, weil die Filme so gut ankamen. Da gab es doch etwas sparsame Reaktionen angesichts langer Abhandlungen und dann doch ziemlich fieser Dino Action.
@Aztlan genau, das Baby.... Muss in Jurassic Park sein.
Aztlan
Ciudadano de Aztlan. Guerrero del Ejército Azteca
Seitdem hasse ich Compys, die werden on sight eliminiert@Aztlan genau, das Baby.... Muss in Jurassic Park sein